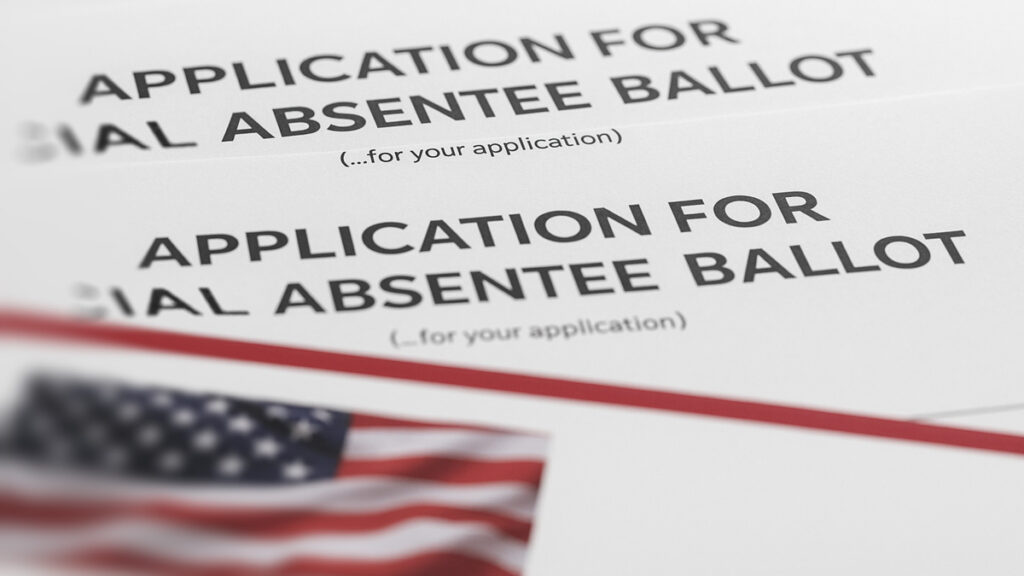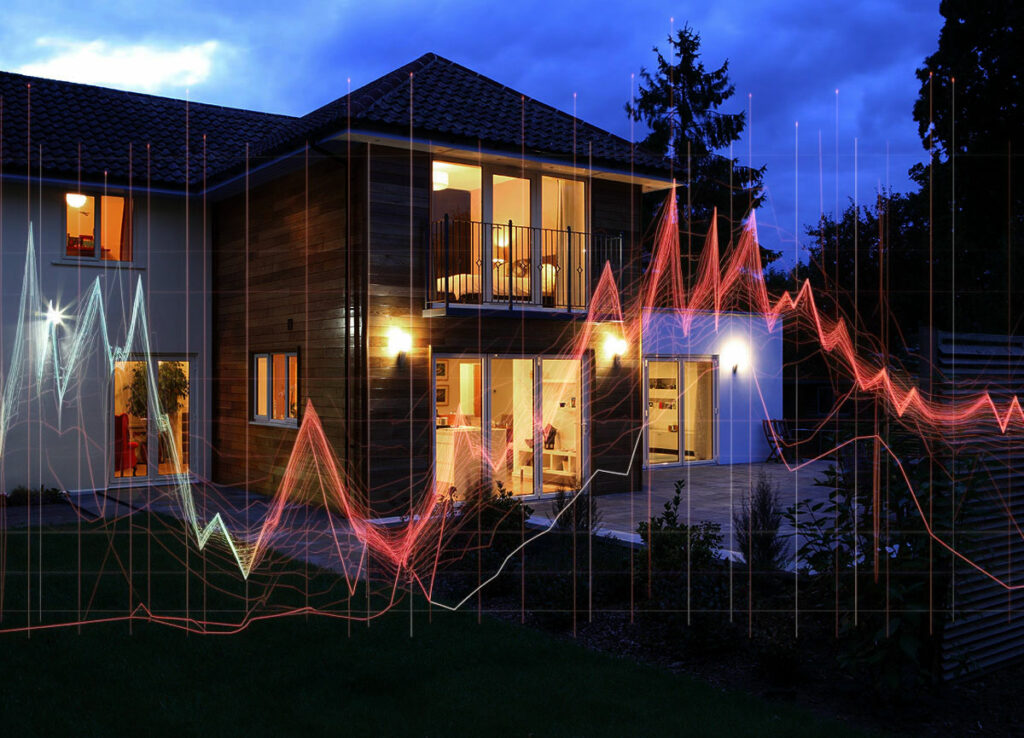Teil 1: Grundzüge von Trumps Politik
Die Trump-Regierung richtet die USA derzeit ökonomisch sowie innen- und außenpolitisch völlig neu aus. Dass es dazu kommen würde, war mit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA klar. Nichtsdestoweniger wurden viele von der Geschwindigkeit und der Radikalität der ergriffenen Maßnahmen überrumpelt.
a) Innenpolitik
Mit einer Flut von Dekreten treibt Trump den Umbau des Staates voran, besonders im Bereich des öffentlichen Dienstes. In den ersten Wochen von Trumps zweiter Amtszeit wurden bereits Tausende Bundesangestellte aus dem öffentlichen Dienst gedrängt. Damit sollen nicht nur die Staatsausgaben gesenkt, sondern auch die Behörden gefügig gemacht werden, indem wichtige Positionen mit ihm loyalen Leuten besetzt werden. Auch führt Trump einen Kampf gegen die Wissenschaft: Er kürzt Budgets, entlässt Forschende und führt einen rechten Kulturkampf. Ganze Forschungsfelder stehen womöglich vor dem Aus, die Wissenschaftsfreiheit in den USA ist massiv bedroht.
b) Außenpolitik
Spätestens am 28.02.2025, als US-Präsident Trump und sein Vize JD Vance den Präsidenten der Ukraine Selenskyi im Oval Office vor aller Welt öffentlich demütigten, zeigte sich das Gesicht der neuen US-amerikanischen Außenpolitik: Wie im 19. Jahrhundert gedenkt man als Großmacht gewisse Regionen der Welt zu kontrollieren und sich über die Köpfe der Betroffenen hinweg mit anderen Großmächten über Einflusssphären zu verständigen. Die Forderung an die Ukraine, sich für empfangene US-Militärhilfen in Form eines Rohstoffdeals dankbar zu zeigen, da man sie sonst einstelle, erinnert an das längst vergangen geglaubte Zeitalter des Imperialismus. Die Außenpolitik wird als „Geschäft“ betrieben, westliche Werte und internationale Bündnisse sind für die Trump-Administration bedeutungslos. Verhandelt wird bevorzugt zwischen einzelnen Staaten, Bündnisse werden höchstens für Deals eingegangen. Die „regelbasierte Weltordnung“, völkerrechtliche Normen und Verträge bilden nicht mehr die Basis des eigenen Handelns.
c) Wirtschaftspolitik
Die Wirtschaftspolitik ist von merkantilistischen Vorstellungen geprägt: Mit Einfuhrzollen möchte Trump das amerikanische Handelsdefizit schmälern. Gleichzeitig soll so verhindert werden, dass US-Vermögenswerte ins Ausland abfließen und stattdessen die Investitionen in die heimische Wirtschaft zunehmen (zu Trumps Wirtschaftsverständnis siehe ausführlicher Teil 2 dieser Artikelreihe). Die am 2. April von Trump verkündeten Zollmaßnahmen für Länder in der ganzen Welt deklarierte dieser zum „Liberation Day“. Damit hat er den Vertrauensvorschuss, den die Kapitalmärkte ihm zu Beginn der zweiten Amtszeit gaben, nachhaltig erschüttert.
Dass Strafzölle eine positive Wirkung auf die US-Wirtschaft haben werden, bestreiten die meisten Ökonomen. Angesichts der globalen Verflechtung ihrer Ökonomie würden sich die USA vielmehr damit ins eigene Fleisch schneiden. Vielleicht hat die Androhung von Strafzöllen für Trump vor allem den Zweck, Druck auf Handelspartner ausüben, um mit ihnen einen für die USA vorteilhaften „Deal“ auszuhandeln.1
Was folgt daraus für Anleger?
Aus investmenttechnischer Sicht stellt sich die Frage, ob die gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Ereignisse die Strategie eines langfristigen und global diversifizierten Investments in ein indexbasiertes Kapitalmarktportfolio infrage stellen.
Von taktischen Gegenmaßnahmen (z. B. Rein-raus-Investieren) raten wir dringend ab. Sie beruhen auf der Prämisse, man könne Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt vorhersehen und entsprechend gegensteuern. Diese Möglichkeit haben aber zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen widerlegt. Sollten Anleger hier doch einmal richtig liegen, haben sie einfach Glück gehabt. In der überwiegenden Zahl der Fälle fügen sich Anleger mit einem solchen Vorgehen einen dramatischen Schaden zu.
Aktien in diversifizierter Form haben sich langfristig als die sich am meisten lohnende Vermögensklasse erwiesen, sind aber auch mit entsprechend höheren Schwankungsrisiken verbunden, die kein Experte oder Analyst prognostizieren kann. Aber eben weil der Aktienmarkt volatil ist, sind Aktienrenditen überhaupt erst möglich, denn Aktienrenditen sind in erster Linie Risikoprämien. Mit einer breiten Diversifizierung kann das Risiko verringert, aber nicht gänzlich ausgeschaltet werden.
Nichtsdestoweniger sollten Anleger das Schwankungsrisiko ihres Gesamtportfolios deutlich verringern, indem sie ihm risikoarme Anlagen beimischen. Diese haben sich während der Finanz- und Bankenkrise 2008/2009 sowie während der Corona-Krise als wirkungsvolle Risikodämpfer erwiesen.
Jede Krise hat ihre Besonderheiten, doch kann keine von ihnen die Regeln eines rationalen Vorgehens im Umgang mit den Kapitalmärkten außer Kraft setzen.
- So prahlte Trump in einer öffentlichen Rede: „Those countries called and kissed my ass. They were anxious to make a deal and said, ‘Please, sir, don’t impose tariffs on us. You can ask me to do anything, anything, sir.’“ („Diese Länder riefen an und küssten mir den Hintern. Sie wollten unbedingt einen Deal machen und sagten: ,Bitte, Sir, erheben Sie keine Zölle gegen uns. Ich werde alles dafür tun, alles, Sir.“) ↩︎